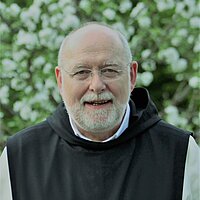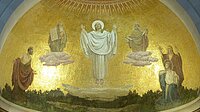Predigt zum 27. Sonntag im Jahreskreis – A – Jes 5, 1-7, Phil 4, 6-9 und Mt 21, 33-42.44.43
Matthäus führt uns heute in eine Fortsetzung der kritischen Worte Jesu an die herrschenden Zeitgenossen, gleichzeitig weitet er die prophetische Kritik aus auf alle im Volk Israel. Das macht deutlich: Auch wir als Christen dürfen uns angesprochen fühlen, wenn es im letzten Vers des Evangeliums heißt: „Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt“ (Mt 21,43). Die Grundlage des prophetischen Wortes finden wir in dem, was Jesaja sagt (vgl. die erste Lesung) und auch in den Worten des Psalms 80(81). Deshalb möchte ich die Worte des Propheten und das Evangelium in ihrer Verbindung betrachten. Schauen wir auf das, was Jesaja sagt.
Die Liebe schafft sich ihre eigene Sprache. Es ist die Sprache der Poesie. Da wird die Geliebte mit der Sonne verglichen oder bescheidener – wie in dem Gedicht von Goethe – mit einem blühenden „Heidenröslein“: „Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehn, sah's mit vielen Freuden.“ Aber auch enttäuschte Liebe findet so ihren Ausdruck: da verwelkt die Blüte und der bunte Strauß verdorrt, die Flamme erlischt, das Feuer erkaltet. In der Bibel finden wir im „Hohenlied“ eine Sammlung von Liebesliedern. In einem davon besingt ein junger Mann seine geliebte Braut so: „Mein eigener Weinberg liegt vor mir“ und er fügt hinzu: „Die tausend lass' ich dir, Salomo“ (Hld 8,12). Der junge Mann will um keinen Preis mit den Weinbergen des Königs tauschen, soll heißen mit dessen vielen Frauen.
Vor diesem Hintergrund dürfen wir das „Weinberglied“ des Jesaja sehen. Mit ihm hat der Prophet einen Text von hoher poetischer Aussagekraft geschaffen. Ursprünglich gehörte das Lied wohl zum jüdischen Laubhüttenfest, dem Erntefest. Die Zeit der Weinlese ist vorüber, Erntedank wird gefeiert, und in den Gassen Jerusalems drängen sich die Menschen. Da tritt ein Straßenmusikant auf und schlägt auf seinem Instrument einige Akkorde an. Den Zuhörern verkündet er, anstelle seines geliebten Freundes werde er ein Lied singen, das dieser Freund über seinen Weinberg verfasst hat. Der Sänger ist der Prophet, der Freund, der, für den er spricht: Nun, das bleibt zunächst offen. Die Zuhörer damals werden mit den Achseln gezuckt haben: Was soll man von einem Lied über einen Weinberg schon groß erwarten? Schließlich ist Erntefest. Und tatsächlich wird im Lied zunächst in aller Kürze nur eine Alltagsgeschichte erzählt: Ein Winzer investiert viel Sorge und Mühe in die Anlage eines Weinbergs. Er wählt eine günstige Hanglage mit geeignetem Boden, pflanzt die beste Rebsorte an, plant – indem er einen festen Wachturm errichtet und eine Kelter baut – für die Zukunft und muss doch eine Enttäuschung erleben: Was er bei der Lese erntet, ist unbrauchbar; alle Arbeit ist vertan.
War es das? Die Zuhörer haben sicher das Lied als Liebeslied erkannt. Sie erinnern sich daran, dass der Weinberg in dichterischer Sprache als Bild für die Braut dient, und schon wird diese Geschichte in Liedform um einiges spannender. Der Freund des Sängers hat eine unglückliche Liebe hinter sich. Er hat um eine junge Frau geworben, mit großem Zeitaufwand und sehr viel Hingabe. Eingetragen hat es ihm nur schroffe Abweisung oder, schlimmer noch, Untreue und Verrat.
Aber auch damit dürfte sich das Publikum noch nicht zufriedengeben. Ist das denn ein Thema für einen Propheten? Nimmt er es dafür auf sich, „Straßentheater“ zu spielen? Dem einen oder anderen mag nun langsam die Erkenntnis kommen, dass auch das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel immer wieder in den Glaubenserzählungen der Alten als Ehe dargestellt wird; zum Beispiel: „Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, wird dein Gott sich über dich freuen“ (vgl. Jes 62,5}. Das Lied handelt also von Jahwe – von Gott – und seinem Volk, besser von der Untreue dieses Volkes. Wer so weit im Zuhören gekommen ist, dem gehen jetzt die Augen auf, weil er auf einmal feststellt: Das Lied, das so verfremdend von einem Freund und seinem Weinberg erzählt, meint im Grunde Israel, das Bundesvolk Gottes, ja, es meint die Zuhörer und Zuhörerinnen selbst; denn es erzählt von Gottes Beziehung zu jedem von ihnen und dem möglichen Misslingen dieser Beziehung.
Jetzt erst ergreift Gott selbst das Wort und spricht sein Volk, immer noch durch den Mund des Propheten, unmittelbar an. Er fordert die Zuhörer auf, zwischen ihm und seinem Weinberg ein Urteil zu fällen, das einem Urteil über sie selbst gleichkommt. Der Urteilsspruch folgt auf dem Fuße. Der Weinberg wird der Verödung preisgegeben und zertrampelt. Die Schlusszeilen des Textes tragen den Grund dafür nach. In einem Wortspiel, sogar im Deutschen erkennbar: Gott hoffte auf Rechtsspruch – doch siehe da: Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit – doch siehe da: der Rechtlose schreit. Die Missachtung Gottes und seines Rechtes – und das ist von zeitloser Gültigkeit – äußert sich in Rechtsbeugung und sozialer Ungerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen. Das ist himmelschreiendes Unrecht, das gerade im Volk Gottes einen Widerspruch in sich darstellt. Und Unrecht vor Gott hat Folgen! Es ist „Sünde“ (von ab-sondern) es bedeutet Trennung von Gott und seiner lebensspendenden Kraft.
Bedrängende Erfahrungen finden so ihre Erklärung, zum Beispiel: Warum sich nämlich das Volk immer wieder als zu schwach erweist gegenüber seinen Feinden; warum es immer wieder seine Freiheit verliert. Die Antwort des Propheten lautet: Weil es die Rechtsordnung Gottes nicht befolgt. All das Gesagte ist zunächst nicht als finstere Drohung gedacht, die Schlimmes als unabwendbar ankündigt, sondern als dringender Appell zur Umkehr. Das, und das allein, ist die Absicht der prophetischen Rede. Und genau darin liegt auch der tiefere Sinn des Gleichnisses vom Weinberg, das Jesus in prophetischer Tradition erzählt. Für den Evangelisten ist dieser Ruf zur Umkehr zurück in die liebende Beziehung zu Gott eine Mahnung auch an die christliche Gemeinde. Sie muss Maß nehmen am Eckstein Christus, wie ein guter Baumeister am Eckstein des zu errichtenden Gebäudes Maß nimmt. Das heißt: Gemeinde und Kirche finden allein in Christus das Maß für ihr Leben. Ohne IHN ist die Gemeinde am Ende.
Seien Sie so von Gott gesegnet und behütet! Ihr P. Guido


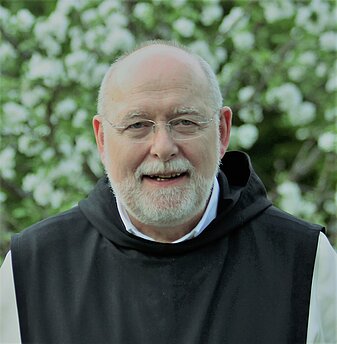

 Bildergalerie
Bildergalerie