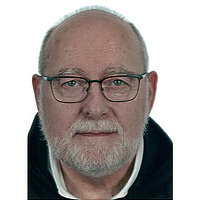Predigt zum 17. Sonntag im Kirchenjahr (B)
2 Kön 4,42-44 und Joh 6,1-15
Die Halbzeit des Kirchenjahres ist ebenso überschritten wie der Zenit des Kalenderjahres. In unserer messbaren Zeit ist das leicht abzulesen. Wann aber der Zenit eines Menschenlebens überschritten ist, weiß keiner - außer Gott. Erst eine rückschauende Betrachtung lässt uns später erkennen, wo der Höhepunkt eines Menschenlebens gewesen sein mag. Am heutigen Sonntag des Kirchenjahres und an den vier folgenden Sonntagen begegnen wir Jesus in dieser Phase seines Weges, am Höhepunkt seines öffentlichen Wirkens. Diese fünf Evangelien-Texte klammern den Evangelisten Markus aus, den wir normalerweise im Lesejahr B hören, und bieten uns das sechste Kapitel aus dem Evangelium des Johannes.
Jesus gibt sich in diesem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums mehr und mehr als der zu erkennen, der ganz von Gott herkommt, als der Gesandte Gottes oder, anders gesagt, es geht um ihn selbst. Jesus selbst gerät damit aber auch immer stärker in Konflikt nicht nur mit den Mächtigen seiner Zeit, sondern auch mit denen, die ihm nachfolgen: Die Brotvermehrung und seine Ankündigung, dass er selbst das Brot des Lebens ist, das einzig Leben in Fülle gibt, und das er in seinem Fleisch und Blut den Menschen als Nahrung zum ewigenLeben anbieten will. Das alles hat irritiert und die Leute verwirrt und erregt Anstoß.
Bei allem, was Jesus an Aufsehenerregendem und in den Augen der Schriftgelehrten und Ältesten an „Anstößigem“ getan hat, bleibt doch in jedem Augenblick deutlich, wie sehr er sich seiner jüdischen Glaubenstradition verpflichtet weiß. So hat Jesus sicher die vielen Bildern und Geschichten seiner Bibel vor Augen. Das gilt auch für das, wovon im heutigen Evangelium die Rede ist. Denn im Zweiten Buch der Könige, aus dem die kurze Lesung dieses Sonntags genommen ist (vgl. 2 Kön 4,42-44), haben wir von dem Gottesmann Elischa gehört, dem ein Mann Brot von den Erstlingsfrüchten bringt, ein Zeichen der Achtung und Verehrung. Zwanzig Gerstenbrote sind es und ein Beutel voll frischer Körner. Elischa nimmt die Gaben an, befiehlt dann aber seinem Diener: Gib es den Leuten zu essen! Der Diener fragt erstaunt, offensichtlich am Realitätssinn seines Herrn zweifelnd: Wie soll ich das hundert Männern vorsetzen? Der aber sagt in aller Ruhe: Gib es den Leuten zu essen! Denn – fügt er hinzu – so spricht der Herr: Man wird essen und noch übriglassen. Der Diener tut, wie ihm befohlen, vermutlich kopfschüttelnd. Und dann geschieht alles so, wie Elischa im Namen des Herrn vorhergesagt hat: Sie aßen und ließen noch übrig.
Bei Johannes geht es in der Geschichte von den fünf Broten und den zwei Fischen nicht wie in dieser Lesung – und übrigens auch nicht wie in den anderen Evangelien – in erster Linie darum,dass die Jünger und damit auch wir heute es mit dem Wenigen versuchen und unter die Vielen geben sollen. Wenn Not ist, müssen wir helfen im Vertrauen darauf, dass es reichen wird und Gott viel mehr daraus machen kann, als wir uns vorstellen können. Das ist unstrittig richtig und gerade in der derzeitigen Notlage durch die Flutkatastrophe oder auch andere Notlagen ein ganz wichtiger Aspekt solidarischen Handelns. Für das vierte Evangelium aber gehört die Brotvermehrung zu den großen Zeichen, die über das Gesehene und Erlebte hinausweisen. Es hat einen eindeutig geistlichen Charakter. Johannes will den „zeigen“ und „offenbaren“, der ganz von Gott herkommt. Gott selbst ist in Jesus der Gastgeber. Ein großes, reiches Mahl findet da statt. Aus fast nichts macht er ein Fest. Brot für einen Tag, das ist viel, das ist alles für den, der hungert. Aber zwölf Körbe voll Reste, das sieht nach Überfülle und sogar nach Schlemmerei aus. Und das soll es auch, ist doch in der Bibel allgemein ein Festmahl Zeichen für die Fülle der endgültigen Heilszeit von Gott her.
Deshalb: Anders als bei Matthäus, Markus und Lukas (vgl. Mk 6,35-44 par) ist es bei Johannes Jesus selbst, der das Brot austeilt; und anders als bei ihnen ist es bei ihm Jesus selbst, der das Einsammeln der Reste veranlasst. Das ist kein Zufall. Um Jesusgeht es, um das, was nur er geben kann. Denn den innerenHunger, die letzte Sehnsucht des Herzens kann nur Jesus selbst stillen. Dieses Brot, dieses Lebensmittel, kann nur aus seinerHand kommen. Dieses Brot hat sich damals auch nicht aufbrauchen können; zu viele Generationen müssen noch davon leben. Zwölf Körbe voller Reste waren es, zwölf Monate hat das Jahr. Die Reste reichen für den Rest der Zeit. Wir essen heute noch davon!
Jesus selbst also teilt das Brot an die Menschen aus. Später (vgl. Joh 6,35) wird er unmissverständlich und zum Ärger seiner Zuhörer – auch den Jüngern ist das zunächst unverständlich – sagen und deuten, was er hier zeichenhaft tut: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern.“ Das sagt er, weil es einen Hunger gibt, den nicht der Magen diktiert, sondern der die Seele zernagt und für den es kein Brot gibt außer ihm.
Das bedeutet: In der Mitte der Zeit, inmitten des Lebens und bei allem, was uns begegnet, ist es Jesus selbst als Brot des Lebens, der allein den Hunger der Seele stillen kann. Je mehr wir teilhaben an diesem Brot, umso mehr haben wir teil an Gottes Wirklichkeit in unserer Welt, sagt doch der Herr: „Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben“ (vgl. Joh 6,51). In diesem Sinne feiern wir die Eucharistie, feiern wir die hl. Messe als eine Feier, die uns für unseren Lebensweg „Reiseproviant“ mitgibt und dann losschickt. Am Ende der hl. Messe werden wir so mit den Worten ausgesandt: „Ite missa est! Gehet hin im Frieden! Gehet, Ihr seid gesandt!“ Gesandt werden wir auf den Weg, den Weg des Lebens, den Weg zu den Menschen, den Weg zu Gott. Die Eucharistie ist „Wegzehrung“, sie nährt als „Pro-viant“, was wörtlich heißt: „für den Weg“, auf allen Wegen, die wir zu beschreiten haben und die wir gehen, um am Ende in Gottes Gemeinschaft, im Himmel anzukommen.
Seien Sie so im Herrn gesegnet und behütet! Ihr P. Guido


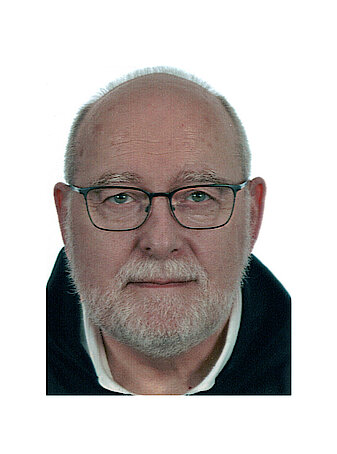

 Bildergalerie
Bildergalerie