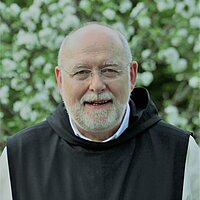Predigt zum 20. Sonntag im Jahreskreis – A – Jes 56, 1.6-7 und Mt 15, 21-28
Warum behandelt Jesus diese Frau, von der wir gerade im Evangelium gehört haben, zunächst so schroff? Etwa deshalb, weil sie eine Heidin ist? Andererseits lobt er doch gerade den Glauben eines heidnischen Hauptmanns, der in Israel seinesgleichen suche, wie er nachdrücklich feststellt (vgl. Mt 8,5-13). Manche behaupten, er habe den Glauben der Frau auf die Probe stellen wollen. Das scheint mir aber zynisch, angesichts des Anliegens der Frau! Schließlich kam sie mit dem Wunsch, dass ihre Tochter geheilt werde. Für mich sieht es eher danach aus, dass Jesus in der Begegnung mit dieser kanaanäischen Frau eine Art Wandel seines Denkens erlebt hat. Das ist beispielhaft für uns alle!
Schauen wir hin: Die Kanaanäerin ruft Jesus an, der weist sie ab, sie lässt aber nicht locker und fleht erneut um die Heilung ihrer Tochter. Und jetzt kommt Jesus ihrer Bitte nach. Was da geschieht, ist doch zweifellos ein Prozess und kein zynisches „Spiel“ mit der Frau. Das verbindet sich mit einem Wort des Lukas-Evangeliums, wo es heißt: „Jesus aber wuchs heran, und seine Weisheit nahm zu“ (Lk 2,52).
Mir scheint es wichtig, die liebenswürdige Menschlichkeit Jesu in Erinnerung zu bringen, die auch - und das nacheinander! - im Hören, Lernen und Handeln zum Ausdruck kommt. Und es wäre doch schön, wenn diese Art Jesu, mit Menschen zu verkehren, abfärben würde auf die Art, wie man in der Kirche miteinander und überhaupt mit Menschen umgeht: Hinhören - Lernen - und nicht gleich alles besser wissen wollen und dann erst Handeln. Was wir bis jetzt wahrnehmen können, deutet auch daraufhin, dass sich in dem geschilderten Geschehen wichtige Fragestellungen der Gemeinde des Matthäus verbergen. Für sie hat er ja sein Evangelium aufgeschrieben und sie erwarten von Jesus selbst Weisung. Das wird deutlich, wenn man die Haltung der Jünger sieht: „Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her!“ (Mt 15,23).
Jesus ist Jude, und er versteht sich von dort, wo er herkommt. Er kennt die Ansichten seiner Zeitgenossen und nimmt ihre überkommenen Vorstellungen ernst. Er belässt es aber nicht beim Bestehenden. Er überwindet die verbreitete Überzeugung, dass Nicht-Juden keine Heilschancen hätten. Er wirbt um die Antwort aller Menschen. Die Antwort, die er bei ihnen sucht, heißt Glaube, heißt Vertrauen darauf, dass Gott sich jedem Menschen zuwendet. Der Glaube aber ist nicht auf wenige, nicht nur auf die Angehörigen eines Volkes, begrenzt. So überschreitet Jesus Grenzen, um deutlich zu machen, dass Gott alle Menschen in sein Reich beruft. Das ist auch eine wichtige Perspektive für das Selbstverständnis von uns Christen heute, denn man glaubt nie nur für sich selbst, sondern immer für und mit anderen.
Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Seit den Tagen der Apostel, spätestens seit Paulus, will sich die Kirche doch gerade in der Gestalt der heidnischen Frau und des heidnischen Hauptmanns wiederfinden. Nicht für ein Volk ausschließlich, sondern für alle Menschen, die an Christus glauben, ist das Heil bestimmt. Von daher definiert die Kirche ihren Missionsauftrag. Sie kann und darf kein Raum mit verschlossenen Türen sein, hinter denen sich wenige Auserwählte versammeln. Der christliche Glaube sucht das einladende Miteinander; und es widerspricht geradezu dem Wesen des Christentums, Menschen, die anders oder gar nicht glauben, geringzuschätzen. Was vom Herrn her, von seiner Botschaft und seinem Auftreten prägend für die Kirche und die Gemeinde ist: Sie muss ZEICHEN sein und werden für das Handeln Gottes am Menschen. In diesem Sinne ist sie Ursakrament für die Welt, ein Geschenk der Liebe für alle Menschen. Aber bis man das so gesehen hat und diese Überzeugung den Alltag der Gemeinde prägte, war es ein Weg der Erkenntnis, besser ein Weg des Hörens, des Lernens und des Handelns. Im Grunde muss es so bis heute sein!
Nun ja! Ich habe ein Ideal beschrieben: eine Gemeinschaft von Glaubenden, die sich ihres Glaubens dankbar erfreut, die auch darin feststeht, deren Festigkeit aber nicht Starrsinn bedeutet, sondern Offenheit. Wir wissen aber aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, vorurteilsfrei zu leben, dieses Offensein aus dem Glauben wirklich umzusetzen und das vor allem deswegen, weil wir uns des eigenen Glaubens oft viel zu unsicher sind. Unsere Welt ist durchzogen von einer Unzahl von Barrieren, von Gegensätzen, die unüberbrückbar scheinen, in Ost und West, in Nord und Süd. Arm hat Angst vor reich und umgekehrt, es herrscht viel Sprachlosigkeit.
Die Kirche selbst ist in verschiedene Bekenntnisse gespalten, und es sieht nicht so aus, als ob sich diese Spaltungen so schnell überwinden ließen. In der Kirche gibt es nicht wenige Gruppen und auch einzelne, die ihre Art zu glauben und den Glauben zu leben absolut setzen möchten, die immer wieder anderen meinen, beweisen zu müssen, dass diese im Unrecht sind. Somit ist nach wie vor die Gefahr greifbar vorhanden, andere maßregeln oder gar ausschließen zu wollen.
Sicher hat sich in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, manches zum Positiven gewendet. Natürlich ist es ein schwieriger Weg und eine Anstrengung, nicht nur zu bekennen, dass Gott das Heil aller Menschen will, sondern auch die Verschiedenartigkeit, die es auf dem Weg des Heiles gibt, zuzulassen und anzuerkennen. Ja, auch wir stecken immer noch – und werden es sicher auch weiter sein – im Prozess des Hörens, des Lernens und des Handelns. Am Ende des heutigen Evangeliums und des darin geschilderten Wandels im Denken und Handeln Jesu steht eindeutig die pfingstliche und so vom Heiligen Geist gewirkte Botschaft von der Überwindung der Grenzen und die Verurteilung der Lehre einer ausschließenden Auserwählung, die Menschen oder Völker für sich in Anspruch nehmen wollen.
Wenn die Kirche in jener heidnischen Frau ihr Vorbild hat, dann muss sie sich auch in allen gequälten Schwestern und Brüdern gequält sehen. Wenn die Kirche vom Geschenk der Hoffnung, das in ihr lebt, spricht, dann muss sie auch mit all denen, die innerhalb und außerhalb des Christentums von ihrer Hoffnung Zeugnis geben, sprechen. So stehen wir als Gemeinschaft der Glaubenden nicht gegen, sondern für die ganze Welt. Entscheidend ist das Wort Jesu: „Frau, dein Glaube ist groß!“ (Mt 15,28). Dies ist eine Zusage, die sich jeder einzelne und auch die Kirche immer wieder vom Herrn erbitten muss.
Seien Sie gesegnet und bleiben Sie behütet! Ihr P. Guido


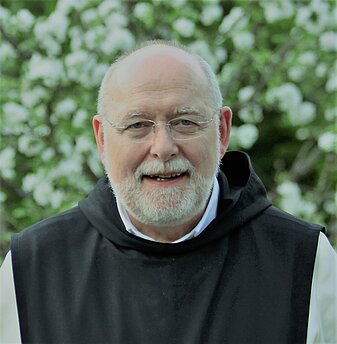

 Bildergalerie
Bildergalerie