Predigt zum 6. Sonntag im Jahreskreis – C – Jer 17,5-8 und Lk 6,17-18a.20-26
In diesem Jahr sind wir in den Sonntags-Evangelien auf der Spur des Evangelisten Lukas unterwegs. Er hat, wie jeder der Evangelisten, eine ganz eigene Sichtweise auf die Geschichte und das Wirken Jesu. Deutlich wird das nicht nur in Details seines Evangeliums, sondern auch, wenn er im Gegensatz zu den anderen, eigene Schwerpunkte setzt oder aus nur ihm eigenen Erzählgut bemerkenswerte Aspekte der Botschaft Jesu hervorhebt.
Was uns im Matthäusevangelium als Rede vom gottnahen Ort des Berges als Seligpreisungen zugesagt wird (vgl. Mt 5,2-12), das spricht nach Lukas Jesus in der Ebene aus. So hieß es im Evangelium: „Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen“ (Lk 6,17).
Die Ortsangabe der Ebene bedeutet mehr als ein nur kleines Detail. Für die Verkündigung des Lukas ist sie von großem Gewicht. Warum? Für ihn, den Arzt und Menschenfreund, zeigt sich das wunderbare Geschehen der Befreiung des Menschen aus seinen Ängsten und aus der Fesselung des Eigenwillens und der Sünde als Bewegung von oben nach unten also in der Erniedrigung. Lukas erzählt die Kindheitsgeschichte – und wir haben uns zur Krippe hinabgebeugt, in die Gottes Sohn herabgestiegen ist. Der unendlich große und unfassbare Gott wird in Jesus Mensch, damit der Mensch den Weg zu Gott wieder finden kann. Und in seinem ganzen Evangelium setzt sich diese Bewegung fort. Gott bleibt nicht fernab in der Höhe. Er stellt sich in seinem Sohn auf Augenhöhe mit dem Menschen, weil er nur so ihm liebend nahe sein kann. Ja, er ist – so erfuhren wir es bei der Taufe Jesu am Jordan (vgl. Lk 3,15-22) – in der Reihe der Kleinen, der Schwachen, der Sünder zu finden. Genau mit ihnen hat und schafft er Gemeinschaft, eine neue Gemeinschaft von Menschen, mit denen er die Welt zur Vollendung führen will.
Deshalb ist es nur konsequent, dass die Seligpreisung der Armen, der Hungernden, der Weinenden und der Ausgegrenzten in Augenhöhe mit dem Menschen ausgesprochen werden muss. Das ist typisch Lukas! Also nicht von der Höhe des Berges, sondern in der Ebene des Alltags finden wir Gottes Sohn: Wie vorab Mose steigt Jesus nach einer Zeit des Gebetes und der Sammlung vom Berg herab, wo viele Menschen sich sammeln, um ihn zu hören (vgl. Ex 19). Dennoch ist es die große Schar der Jünger, denen zuerst der Blick Jesu und auch sein Wort gilt, denn sie stehen, wiederum vergleichbar den siebzig Ältesten aus dem Gottesvolk Israel, stellvertretend für die urchristliche Gemeinde (vgl. Ex 19,7). Lukas macht deutlich: Gottes Liebe führt zur Haltung der Demut, zur Anerkennung des Menschseins, denn in den Augen Gottes ist der Mensch so kostbar, dass er hinabsteigt vom Göttlichen zum Menschlichen, um dem Menschen göttliche Zukunft zu schenken. Jesus wird diesen unteren Weg weitergehen bis hin zum Kreuz, bis in den Tod in der Verachtung, um in der Auferstehung von den Toten und im Hinabsteigen in das Reich des Todes (siehe das apostol. Glaubensbekenntnis) Gottes Plan der Liebe zu vollenden.
Da ist noch etwas, das wir sehen müssen: Die Jesus nahestehenden Apostel, die Schar der Jünger und die Menge der Menschen, die sich zusammenfanden, sie spiegeln in etwa die Struktur der lukanischen Gemeinde wider. Damit gewinnt das, was als Inhalt der sogenannten „Feldrede“ ausgesagt wird, eine für die Gemeinde und über sie hinaus für die ganze Welt programmatische Bedeutung.
In Anlehnung an das Prophetenwort des Jeremia – wir hörten es in der Lesung – korrespondieren die lukanischen Seligpreisungen (im Unterschied von acht Seligpreisungen bei Matthäus sind es bei Lukas nur vier) mit „prophetischen Wehe-Rufen“. Dieser Gegensatz erläutert die Botschaft: Wer auf der Augenhöhe mit Gottes Sohn ist, dem wird das wahre Glück zuteil: Jetzt in der Gemeinschaft und für immer in Gottes Zukunft. Wer im Vertrauen auf Gottes Handeln sich mit ihm verbunden weiß, dessen Leben hat ein stabiles Fundament und Gottes Verheißungen werden sich an ihm bewahrheiten und sein Leben wird sich in Gott vollenden. Die Not der Armen, die Hungernden und die Weinenden werden nicht spirituell überhöht betrachtet und sie werden nicht wegen ihres Zustandes an sich gepriesen. Nein, Jesu spricht von dem her, was sich in und mit IHM vollenden wird. Die Gemeinschaft mit Jesus und dem in ihm handelnden Gott ist entscheidend der Gegenwart und in der Zukunft Gottes. Diese Perspektive öffnet den Blick und die Tat vom Hier und Heute auf die sich in Gott vollendende Welt. Lukas schaut vom Heilshandeln Gottes in Jesus von Ostern und der Auferstehung her auf die Not und das Leid. Das wird kontrastierend abgebildet, wenn man auf die „prophetischen Wehe-Rufe“ schaut. Denn sie sagen: Wer sich unsolidarisch absetzt vom Handeln Gottes, und in seinem Leben allein auf eigenen Reichtum, auf egoistisches Wohlergehen und auf bloße Oberflächlichkeit setzt, wer sich also in seinem Reden, Denken und Handeln allein im Hier und Jetzt erschöpft und die Augen verschließt vor dem Elend und Leid und der Möglichkeit, mitzuwirken an der Zukunft Gottes, der hat schon alles. Überspitzt könnte man den Gedanken der Rufe fortsetzen und sagen: So jemand braucht folglich auch keine Erlösung… Der braucht auch keinen Himmel, der braucht auch keinen Gott, keine Liebe und keine Hoffnung und keinen Glauben, die über die Erde und die Vergänglichkeit alles Materiellen hinwegweisen… Darin liegt der prophetische Charakter der „Wehe-Rufe“.
Diese Rufe sind eine ernste Mahnung an alle, die der Auffassung sind, sich ihr Glück selbst und allein selbstbezogen sichern zu können.
Wie sagte es der Prophet Jeremia? „Verflucht der Mensch, … dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist“ (vgl. Jer 12,5.7). Wenden wir uns also dem Herrn zu und leben wir mit ihm, um das Leben zu gewinnen!
Seien Sie gesegnet und behütet! Ihr P. Guido


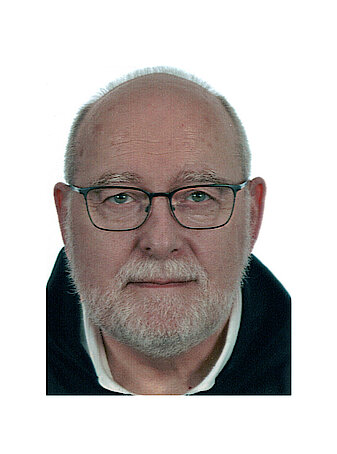

 Bildergalerie
Bildergalerie 














