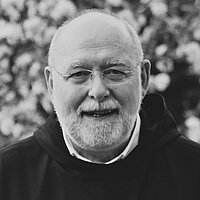Predigt zum 30. Sonntag im Jahreskreis A – Ex 22, 20-26; 1Thess 1, 5c-10 u. Mt 22, 34-40
Matthäus nimmt im Fortgang des Evangeliums Bezug auf die Situation im Vorfeld (vgl. Mt 22,23-33). Dort hatte Jesus den Sadduzäern in der Frage nach der Auferstehung eine gekonnte Abfuhr erteilt. Jetzt sind wie in einem Partnerwechsel nach den Sadduzäern die Pharisäer wieder an der Reihe. Es scheint nur eine theoretische oder wie man sagt „akademische“ Frage, die ein pharisäischer Gesetzeslehrer Jesus stellt. Aber er hat natürlich einen Hintergedanken bei seiner Fragestellung. In der Beachtung der Weisungen des Gesetzes gelten, so haben es die Gelehrten damals herausgearbeitet, buchstäblich 613 Ge- und Verbote als gleichermaßen wichtig und verbindlich. Will man also vom jüdischen Glauben her richtig und unangefochten sein Leben gestalten, dann muss man sich an alle diese Ge- und Verbote halten. Der Hintergedanke des Fragenden war es also, dass Jesus sich in der ganzen Gesetzeskasuistik verfangen würde. Er wäre mit einer falschen Antwort absolut diskreditiert.
Jesus antwortet, indem er aus zwei Büchern des Alten Testamentes zitiert. Zunächst aus dem Buch Deuteronomium „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken“ (Dtn 6,5), und dann aus dem Buch Levitikus „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18). Jesus nennt also das Gebot der Gottesliebe als das wichtigste und erste, stellt aber das der Nächstenliebe als ebenso wichtig auf die gleiche Stufe. Gottes- und Nächstenliebe lassen sich in seiner Auffassung nicht trennen. Vielmehr ermöglichen und tragen sie einander. Damit geht Jesus einen wichtigen Schritt weiter als die jüdischen Gesetzeslehrer seiner Zeit. So heißt es im babylonischen Talmud vom berühmten Gesetzeslehrer Hillel:
„Einst kam ein Römer zu Hillel und sprach: ‚Ich bin bereit, an euren Gott zu glauben, wenn du mir seine Lehre beibringen kannst, während ich auf einem Bein stehe.‘ Hillel sagte ihm: ‚Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst – das ist die ganze Lehre, der Rest ist Erläuterung dazu. So gehe nun, und lerne auch die Erläuterung.‘“ (Babyl. Talmud, Traktat Schabbat 31a).
Für Hillel steht es außer Frage, dass alle 613 Ge- und Verbote der jüdischen Lehre zu befolgen sind, eben weil sie die Auslegung des Liebesgebotes darstellen, sie sind die erwähnte Erläuterung. Nur wer sie beachtet, erfüllt das Gebot der Nächstenliebe ganz.
Jesus sieht das anders. Wenn er sagt, dass an den beiden Geboten der Gottes- und der Nächstenliebe das ganze Gesetz samt den Propheten hängt, dann heißt das: Wer Gott und den Nächsten liebt, erfüllt schon die ganze Weisung, das ganze Gesetz, das heißt den Willen Gottes. Damit aber sind im Grunde die 613 Einzelvorschriften, die Ge- und Verbote des Gesetzes aufgehoben, weil sie in der Verbindung von Gottes-, Nächsten und Selbstliebe aufgehen.
Wie aber, so muss man spätestens jetzt fragen, wie lieben wir Gott? Ihn sehen wir nicht und können ihn nicht greifen! Wie ihn also lieben? Ist die Forderung Jesu utopisch?
Nun, es ist klar, dass die Gottesliebe keine romantische Schwärmerei ist. Sie ist auch keine private Seelenregung oder esoterische Einbildung. Heute, das heißt im Kontext von Naturwissenschaften und Aufklärung müssen wir die Gottesliebe neu beschreiben als grundlegende Suche nach Gott und auch als ein Fragen nach dem Urgrund unseres Glaubens und Handelns. Gerade weil Jesus Gottes- und Nächsten- und Selbstliebe untrennbar miteinander verknüpft, ist die Suche nach Gott und die Frage nach dem Urgrund des Glaubens immer auch die Frage nach dem Menschen und seinem Sein. Der Schlüssel für diese Sichtweise ist die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Der 1. Johannesbrief macht die Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe greifbar: „Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht.“ (1Joh 4,20). Den Mitmenschen, den Bruder und die Schwester zu hassen, schließt also aus, dass man Gott lieben kann. Genauso deutlich muss man es sagen! Im Kontext dieses Gedankenganges ist es auch nicht möglich, sich selbst zu bejahen, wenn der Mitmensch und Gott im Denken und Handeln des Ich außen vorbleiben. Nur wenn sich im Beziehungskreis „Gott – Du – Ich“ gegenseitig befruchten und der Kreis geschlossen ist, dann ist ein gelingendes und versöhntes Gestalten des Lebens wirklich möglich. In der Ethik und der Moral des Christentums, im Ganzen des christlichen Glaubens geht es nicht um die Erfüllung von Vorschriften, Ge- und Verboten. Vielmehr zeigt sich hier wie insgesamt in der Botschaft Jesu eine ungeheuer große und dynamische Beziehungswirklichkeit. So wirkt sich die Liebes-Ethik Jesu aus. Sie ist gerade deshalb auch eine Ethik der Freiheit, denn sie ist nicht abhängig von menschlicher Machbarkeit. Es ist Gott selbst, der sich offenbart als der dem Menschen Zugewandte, der Liebende. Dabei geht die Liebe immer von Gott aus und hat auch ihn letztlich zum Ziel. Weil wir aber selbst von Gott in Liebe angeschaut und angenommen sind, werden wir auch in Liebe antworten. Die Forderung der Gottesliebe ist also keine Utopie. Vielmehr sucht die Liebe immer nach der Liebe selbst. Und noch eins: Gottesliebe und Gotteserkenntnis kommen zusammen. Jesus gestaltet die Tradition seines jüdischen Glaubens weiter, indem er die Aussagen der Hl. Schrift in neue Beziehung setzt: Er bringt den Menschen und Gott neu zusammen!
Mir kommt eine chassidische Erzählung in den Sinn, die ich hilfreich finde:
Ein Rabbi fragte seine Schüler: „Könnt ihr mir sagen, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt?“ Einer glaubte es zu wissen: „Vielleicht dann, wenn man von der Ferne einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann?“ – „Nein“, antwortete der Meister. „Wenn man einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann!“, glaubte ein anderer Schüler zu wissen. Darauf sagte der Rabbi: „Nun gut, ich will es euch sagen. Dann, wenn ihr in das Gesicht eines Menschen schaut und euren Bruder oder eure Schwester darin erkennt, dann wird es Tag.“ Mit Jesus interpretiert heißt das: Im Mitmenschen erkennen wir Gott… Wer also immer sich auf Gott beruft, kann nicht hassen, nicht zerstören, nicht morden. Wer anders denkt und handelt, widerspricht dem Menschsein nach Gottes Bild. Er handelt gegen den Bund Gottes mit dem Menschen, vom der Prophet Jeremia sagt:
„Das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe – Spruch des Herrn: Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz… Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen ‚Erkennt den Herrn!‘ sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen“ (Jer 31,33f).
Seien Sie in der Liebe Gottes gesegnet und behütet! Ihr P. Guido


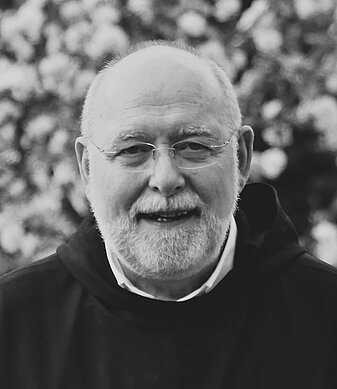

 Bildergalerie
Bildergalerie