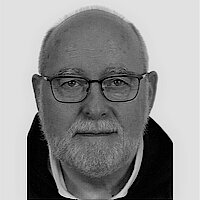Betrachtung zum Karfreitag 2021 – Vom König auf dem Kreuzesthron (Joh 18,1 – 19,42)
An jedem Karfreitag vermag uns die Passionserzählung des Johannesevangeliums immer neu zu ergreifen. Vielleicht deshalb, weil sie im Vergleich mit den Leidensgeschichten der anderen Evangelien die sprachlich eindringlichere darstellt.
In der Johannespassion ist nur wie aus feierlicher Distanz die Rede von Schmerz, von Leid und Not; Menschliches und Mitmenschliches treten eher in den Hintergrund – so scheint es. Das Gebet Jesu am Ölberg etwa wird ebenso wenig erzählt wie die Verspottung Jesu am Kreuz durch die Hohenpriester. Für den Verfasser des Johannesevangeliums wird nicht in erster Linie ein Mensch am Kreuz gemartert und zu Tode gebracht, sondern hier vollendet eine hoheitliche, eine königliche Gestalt ihren Weg, auch wenn dieser Weg ans Kreuz führt.
Es ist so, wie es im Text des Eingangschores der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach heißt:
„Herr, unser Herrscher,
dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist!
Zeig uns durch deine Passion,
dass du, der wahre Gottessohn,
zu aller Zeit,
auch in der tiefsten Niedrigkeit,
verherrlicht worden bist.“
Mehrmals unterstreicht der Evangelist die Hoheit Jesu und schafft damit jene unausgesprochene Distanz, die zwischen Jesus und seinen Gegnern herrscht: Bei der Gefangennahme weichen die Tempelsoldaten zurück; sie stürzen gar zu Boden, als Jesus von sich bekennt: „Ich bin es!“ (vgl. Joh 18,6). Das ist noch eindeutiger als jene „Ich-bin-Worte“ es sind, die wir aus früheren Kapiteln des Johannesevangeliums kennen: „Ich bin das Brot, die Wahrheit, die Auferstehung, das Leben, der gute Hirt, die Tür, der Weg“ (vgl. Joh 6,51; 8,12; 10,9; 10.11; 11,25; 14,6).Jetzt, da der entscheidende Moment der Sendung Jesu anbricht, jetzt, da seine „Stunde“ sich zu erfüllen beginnt, um dann am Kreuz tatsächlich ans Ziel gebracht zu werden, sich also sein Lebensauftrag vollenden wird, jetzt heißt es in uneingeschränktem, hoheitsvollen Selbstbekenntnis: „Ich bin (es)!“ Dieses Ich Jesu behält auch in der Leidensgeschichte jene besonderen Züge, die im gesamten Johannesevangelium prägend sind: Jesus geht als Wissender in die Passion und in das Sterben. Er ist nicht einfach ein Opfer grausamer und unmenschlicher Verhältnisse. Er behält vom Anfang bis zum Ende die Initiative in der Hand. Schon bei seiner Gefangennahme weiß er um das, was kommen soll, und im Augenblick des Todes weiß er, dass nun alles zur Vollendung geführt ist. Dieses Wissen hebt Jesus von seiner Umwelt ab. Es gibt ihm jene Überlegenheit, die sowohl im Verhör vor dem Hohenpriester wie auch im mehrteiligen Gespräch mit Pilatus zum Ausdruck kommt. Da ist nicht einer, der als Beschuldigter auf ein mildes Urteil hofft, sondern da ist einer, der letztlich über der Sache steht, dem nichts und niemand etwas anhaben kann, auch wenn er dabei zu Tode kommt. Der Evangelist will deutlich machen: Es geht Jesus nicht darum, in diesem Scheinprozess zu freigesprochen zu werden, sondern darum, jenen Becher zu trinken, „den der Vater gegeben hat.“ Der Becher steht für das ihm vom Vater zugeteilte Geschick.Das ist der Kernpunkt. Anlässlich des Gesprächs mit der Samariterin am Jakobsbrunnen hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: „Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden“ (Joh 4,34). Dieses Wort steht hinter der Sinngebung der Passion, damit eben Gottes Wille vollendetwerde. Dieser „Wille Gottes“ – so verdeutlicht es der Evangelist – besteht aber keineswegs darin, dass Jesus unbedingt sterben muss, damit Gott wegen der Verfehlungen der Menschen zufrieden oder versöhnt sein kann. So denken wir Menschen. In unserem allgemeinen Verständnis kommt Sühne ja nur durch den Ausgleich des Gegenwertes zur Verfehlung zustande. Gott denkt und handelt anders. Er wählt den Weg des Herzens, den Weg der Liebe und verzichtet auf Macht: Als Gegenwert zur Verfehlung des Menschen setzt er seine Liebe ein. Gottes Wille und Werk ist es, in der Person Jesu diese seine Liebe kundzutun und diese Liebe gegenwärtig zu setzen, sie Gestalt werden zu lassen. Weil dieses Anliegen bei den damals Herrschenden auf Ablehnung und Widerstand stößt, kommt es zum Konflikt. Sie stellen menschlich beschränkt den Buchstaben des Gesetzes und ihr menschliches Denken über das Geschenk der Liebe und Versöhnung. „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf“, heißt es schon im Prolog des Johannesevangeliums (vgl. Joh 1,11). Dieser Auseinandersetzung, deren tödlicher Ausgang ja vorhersehbar ist, entzieht sich Jesus nicht, sondern handelt, wie er sein ganzes Leben lang gehandelt hat: Er steht bis zum Letzten ein für das Wirken und Handeln des liebenden Gottes; oder anders gesagt: er vollendet mit seinem Leben seinen Auftrag und zugleich sein Zeugnis von einem Gott, der bedingungslos liebt. So wird die Erhöhung am Schandpfahl des Kreuzes zur Erhöhung des liebenden Menschen- und Gottessohnes. Er ist der König auf dem Thron des Kreuzes. Das Wort, das Jesus vor Pilatus spricht, bewahrheitet sich: „Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.“ (Joh 18,37). Auch wenn Pilatus in seinem Misstrauen und in seiner Machtskepsis diese Worte Jesu nicht verstehen kann und mit sarkastischem Unterton fragt: „Was ist Wahrheit?“
Und wir? Wir stehen staunend vor diesem Geschehen und knieen nieder vor der unfassbaren Größe der Liebe Gottes. Öffnen wir unser Herz weit, damit sie bei uns ankommen kann.
Seien Sie gesegnet und behütet in der Liebe Gottes!
Ihr P. Guido


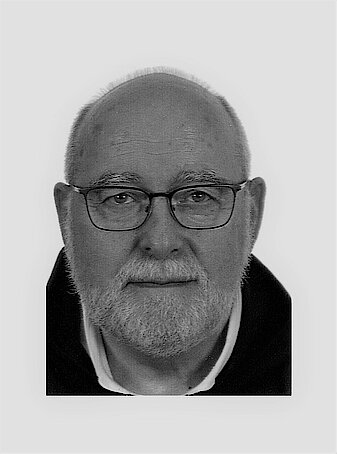

 Bildergalerie
Bildergalerie