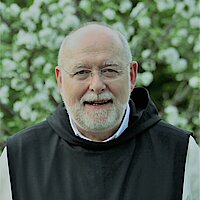Predigt zum Dreifaltigkeitssonntag Röm 5,1-5 und Joh 16,12-15
Dreifaltigkeit… Eine dogmatische Aussage. Ist sie für uns hilfreich? Wer, wie und was Gott ist, war immer in der religiösen Geschichte des Menschen eine Frage, die oft nur spekulativ betrachtet wurde und oft auch heute noch wird. Wie kann man die Gottesfrage anders stellen? Und was bedeutet solch ein Glaubensbegriff wie „Dreifaltigkeit“?
Schauen wir auf unsere eigene Wahrnehmung. In der Begegnung mit anderen Menschen ist letztlich eine Frage ganz entscheidend. Sie lautet: Wer ist es, der oder die mir da begegnet? Wer bist du? Es ist die Frage nach dem Wesen, nach dem Charakter, nach der Persönlichkeit. Von der Antwort auf diese Frage machen wir – wenn es sich um eine echte Begegnung handeln soll – unser Reagieren, unsere Offenheit abhängig, schlicht, wir entscheiden auf Grund unserer Antwort, wie weit wir anderen vertrauen und ob unsere Begegnung tiefer gehen kann.
Diese Frage in Bezug auf die Mitmenschen stellen wir auch auf Gott hin – denn er ist ja auch ein Gegenüber – ist deshalb so entscheidend und wichtig, weil wir Menschen von der Grundanlage unseres Wesens auf die anderen ausgerichtet sind. Der Philosoph und Theologe Martin Buber sagte das einmal so: Das ICH wird am DU. Erst in der Begegnung, im sich Öffnen hin auf die Mitmenschen und die Welt, im Überwinden der eigenen Grenzen und Begrenztheit entdecken wir uns und finden uns selbst. Wir können also feststellen: Wir Menschen sind grundsätzlich auf Begegnung und damit auf Beziehung angelegt. Wenn wir das von uns selbst sagen können, dann dürfen wir so auch auf den hin reflektieren, der uns geschaffen hat, auf Gott hin. Denn wir sind ja sein Ebenbild – wie es die Bibel sagt. Wir können also sagen: Wenn wir auf Begegnung hin geschaffen sind, dann ist Gott das auch. Aber da es niemand gibt, der ihn so geschaffen hat, dann muss Gott selbst in sich Begegnung sein und Begegnung in die Tiefe des eigenen Wesens hinein ist Annahme, ist Dialog, ist Liebe. Gott muss also in sich mehr sein als EINER. Der heilige Augustinus hat das schon lange vor uns gesehen und sagt dazu: „Wo es die Liebe gibt, gibt es eine Dreifaltigkeit: Einen Liebenden, einen Geliebten und die Quelle der Liebe.“ Augustinus deutet also eine menschliche Erfahrung und bringt den Glaubensbegriff der Dreifaltigkeit ein.
Wenn wir so danach fragen, wer Gott ist, dann hören wir auf das Zeugnis der Menschen, die ihn erfahren und davon erzählen. Sie sagen uns: Aus sich selbst heraus zeigt und offenbart sich Gott konkret in Jesus dem Gottes- und Menschensohn, der davon spricht, dass er und der Vater eins ist, und der ebenso davon spricht, dass der Heilige Geist alles lehren und offenlegen wird, was vom Vater und vom Sohn ausgeht (vgl. Joh 16,13f). Wir können also über Gott etwas erfahren, weil er selbst sich uns öffnet (offenbart). Und er schenkt es schon damit, dass er den Menschen so angelegt und geschaffen hat, wie er selbst ist: Als Wesen der Beziehung, als Liebenden, als Liebende.
So ist das Wort des Heiligen Augustinus wie ein Pfad, der als Hilfe nicht für das intellektuelle Verstehen, sondern für das biblische ERKENNEN einen entscheidenden Anstoß gibt: „Wo es die Liebe gibt, gibt es eine Dreifaltigkeit: Einen Liebenden, einen Geliebten und die Quelle der Liebe.“ Er umschreibt damit, was wir aus der Botschaft der Hl. Schrift glaubend wissen:
Der Vater hält uns Menschen seinen Sohn hin. Er schenkt ihn uns. Der am Kreuz hingerichtete und sich hingebende Sohn ist das Liebesgeschenk des Vaters an uns Menschen. Der Evangelist Johannes sagt es so: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat" (Joh 3,16). Der Sohn antwortet in der freien Hingabe seines Lebens, im Gleichwerden mit dem Menschen – außer der Trennung von Gott, der Sünde –, dem geliebten Geschöpf Gottes, bis in die tiefste Not des Todes, ja, bis hinab in das Grauen des Todes selbst, damit der Mensch den Weg zum Vater finden kann. Das Geschöpf und der Schöpfer sollen zusammenfinden und eins werden. Darin wird Gott und seine Liebe groß gemacht und geehrt. So sagt Jesus am Abend vor seinem Sterben: „Jetzt ist die Stunde da. Verherrliche Vater deinen Sohn…“ (vgl. Joh 17,1.5). Und wieder antwortet Gott selbst: Der Heilige Geist ist die Fülle des Lebens, die Antwort der Liebe: Er lässt den Sohn nicht im Tod. Er schenkt die Auferstehung, Ewigkeit, Gemeinschaft in Gott – er ist die Quelle der Liebe: „Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir“, sagt Jesus mit Blick auf die Jünger und die Menschen, die er lösen will aus der Dunkelheit des Todes und der Angst (vgl. Joh 17,22f). Der Geist öffnet die Augen und das Herz für diese Wahrheit. Er kündet nicht aus sich selbst, sondern kündet all das, was er vom Vater hört, was also Gottes in sich eigen ist und „Gott ist die Liebe – Deus caritas est“ (1 Joh 4,8).
Wir haben uns in diesen Überlegungen der Frage wer und wie Gott ist durch unsere Betrachtung vom Menschen und seinem Wesen aus genähert. Der Priester und Dichter Andreas Knapp vertieft das noch, indem er in seinem Gedicht „von gott aus gesehen“schreibt:
ist unser suchen nach gott
vielleicht die weise wie er uns auf der spur bleibt
und unser hunger nach ihm das mittel
mit dem er unser leben nährt
ist unser irrendes pilgern
das zelt in dem gott zu gast ist
und unser warten auf ihn
sein geduldiges anklopfen
ist unsere sehnsucht nach gott
die flamme seiner gegenwart
und unser zweifel der raum
in dem gott an uns glaubt
(Andreas Knapp, „Höher als der Himmel“, Echter-Verlag, 3.Aufl. 2015, S.19):
Gott glaubt an uns, an dich und mich. Öffnen wir uns seiner Nähe und Liebe!
Seien Sie gesegnet und behütet! Ihr P. Guido


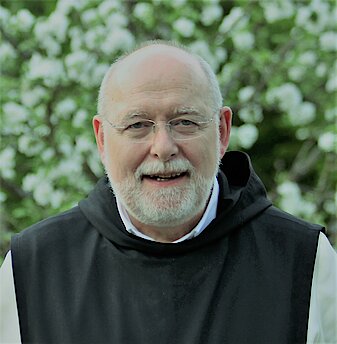

 Bildergalerie
Bildergalerie