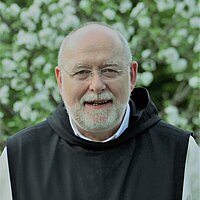Predigt zum 23. Sonntag im Jahreskreis – A – Röm 13, 8-10 und Mt 18, 15-20
Es ist nicht bekannt, ob das, was ich jetzt erzähle, sich tatsächlich so abgespielt hat:
Ein Offizier der Römer, so wird erzählt, wandte sich an einen Rabbi und bot ihm an, er wolle gern den jüdischen Glauben annehmen, wenn es ihm – dem Rabbi – gelänge, das, worauf es dabei eigentlich ankomme, in so kurzer Zeit zu sagen, dass man währenddessen auf einem Bein stehen könne. Der Rabbi überlegte. An die Heiligen Schriften musste er denken, an das Gesetz und die Propheten, an all die Auslegungen und Ergänzungen. Und mit einem Seufzer sagte er: Nein, das Erbetene sei nicht möglich. Zu großartig, zu reich sei der jüdische Glaube, als dass man ihn in solcher Kürze darzulegen vermöchte.
Kurzerhand ging der Offizier zu einem anderen Rabbi und trug diesem seine Bitte vor. Der überlegte nicht lange: „Ja“, sagte er, „alles lässt sich auf einen Nenner bringen“. Dann sagte er: „Alles findest Du in dem Satz: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu“ (= die sogen. „Goldene Regel“). Später ist es ein Gesetzeslehrer, der Jesus danach fragt, worauf es denn eigentlich ankomme: „Welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“ Und er erhält die Antwort: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten“ (vgl. Mt 22,35-40).
Etwa dreißig Jahre später schreibt Paulus an die Römer: „…die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren! und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes“ (vgl. Röm 13,8-10 = Lesung des Sonntags).
Noch einmal etwa Dreihundert Jahre später formuliert der Hl. Augustinus den einprägsamen Satz: „Ama, et fac, quod vis!“ – „Liebe nur, dann magst du tun, was du willst.“
Was der Rabbi, was Jesus, was Paulus und Augustinus gesagt haben, das lebt fort im Ritus der Taufe. Da heißt es zu Beginn: „Liebe Eltern! Sie haben für Ihr Kind die Taufe erbeten. Damit erklären Sie sich bereit, es im Glauben zu erziehen.“ - Nun was bedeutet es, das Kind im Glauben zu erziehen? Heißt das: Kauft einen Katechismus der katholischen Kirche, damit Ihr Euer Kind im Glauben unterweisen könnt.“ Nein! Im Ritus der Taufe heißt es schlicht: „Es soll Gott und den Nächsten lieben lernen, wie Christus es uns vorgelebt hat.“ Und weiter: „Ihr sollt miteinander beten und eurem Kind helfen, einen Platz in der Gemeinschaft der Glaubenden – der Kirche – zu finden.“
Eine gute Beschreibung dessen, was glauben heißt. Der Ritus wiederholt, was der Rabbi, was Jesus, Paulus und Augustinus gesagt haben.
Ich frage weiter: Ist „lernen, miteinander beten und sich in der Gemeinschaft helfen“ eine Art Arbeitspensum, eine Leistung? Muss man sich den Glauben also doch erarbeiten und den Himmel verdienen, und sei es mit der gelebten Liebe? Der Glaube und mit ihm der Himmel ist doch nur als Geschenk zu haben, so haben wir es gelernt. Alles das ist Gnade, hören wir immer wieder.
Ist vielleicht etwas vor dem Glauben? Ja, sage ich und es mag überraschen: Da, wo geliebt wird, ist der Glaube immer schon als Hintergrund da, unbestimmt und offen vielleicht, aber doch als deutlicher Hinweis auf den, der die Liebe selbst ist, auf Gott. Indem er uns liebt, sind wir fähig und begabt zu lieben. Gottes Liebe gilt seinem Geschöpf – das hat er gewissermaßen in die menschliche DNA eingeschrieben. Sonst gäbe es uns nicht, denn wir sind aus Liebe geschaffen. Gott wendet sich dem Menschen in Gnade, also in Liebe zu. Die Liebe ist „die Erfüllung des Gesetzes“ sagt Paulus, wir könnten auch sagen: Die Liebe ist „die Erfüllung, die Annahme des Glaubens“. Und sie allein „genügt“. Ja mehr noch: Die Liebe, die mich leiten soll in allem Tun, kann nur gelingen, wenn ich selbst mich durch den Glauben an Gott in der Liebe geborgen weiß. Der Hl. Bernhard von Clairvaux sagte einmal, dass der Lohn der Liebe die Liebe selbst ist. Recht hat er!
Nur wer sich geliebt weiß, ist auch wirklich zu echter Liebe fähig. Nur wer in dem Glauben lebt, dass er selbst angenommen und bejaht ist, nur der kann auch das „JA“ dem Bruder und der Schwester, dem Mitmenschen und der ganzen Schöpfung Gottes weiterschenken. Nur das Herz, in dem ein solcher Glaube wohnt, ist selbst zur Liebe fähig. Deshalb heißt es im Brief an die Kolosser: „Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld! - Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr“ (Kol 3,12f).
So ist die Liebe immer schon die Frucht des Glaubens und der Glaube an Gott, ist das Geschenk seiner Liebe, ist Geschenk seiner Gnade. Es kommt also nicht zuerst die „Moral“ und dann der Glaube. Vielmehr ist die Liebe des Glaubens Kind. Wenn wir also sagen, dass wir einander lieben sollen, dann bedeutet das, den und die anderen im Vertrauen und im Glauben an Gottes Liebe anzunehmen und einander auf die größere Liebe hin zu begleiten. Die größere Liebe, das ist Gott selbst. Es ist wahr, was der Hl. Bernhard sagt: Der Lohn der Liebe ist die Liebe selbst.
„Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer“ (Röm 13,8), hat uns Paulus empfohlen und damit auch einen Schlüssel zum Verständnis des Evangeliums mit seinen harschen Anweisungen gegeben: „Wenn dein Bruder sündigt, dann ... weise ihn - zunächst - unter vier Augen zurecht“ und wie es da noch weiter hieß.Nicht um Urteilen oder Besser-wisserei und Überheblichkeit darf es gehen bei dieser Gemeinderegel, die die junge Christen-gemeinde aus den Worten Jesu ableitet, sondern um Beistand und gegenseitige Hilfe, die Liebe und den Glauben miteinander zu leben und zu teilen und so den Weg zu Gott zu gehen.
Ihnen Gottes Segen und bleiben Sie behütet! Ihr P. Guido


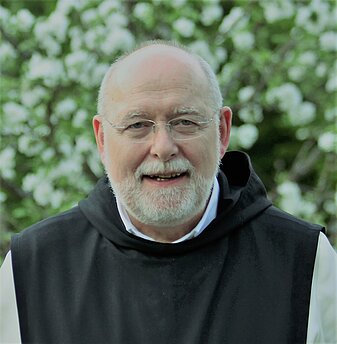

 Bildergalerie
Bildergalerie