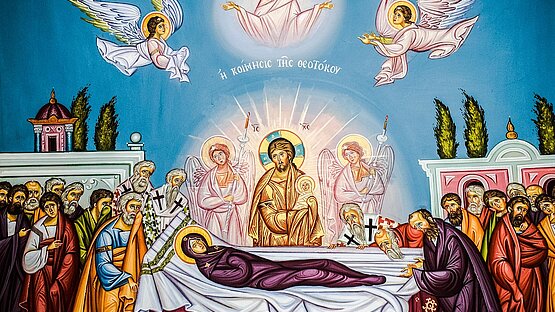Aus den Augen, aus dem Sinn?


Predigt zu Christi Himmelfahrt – B – Apg 1,1-11 und Mk 16,15-20
Jesus verheißt seinen Jüngern, die er als Glaubensboten zu allen Völkern sendet: „Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20). Ist das nicht ein Widerspruch zur Erfahrung der Jünger?
Jesus verlässt sie. Er trennt sich von ihnen, die sie ihn nach seinem Tod als lebend, als ihnen wiedergeschenkt erfahren haben.
Sie schauten unverwandt zum Himmel empor, heißt es: dorthin, wo er ihren Blicken entschwunden ist, fast so, als ob sie ihn wieder zurückholen könnten.
Die Jünger erleben, so wie erzählt wird, „Christi Himmelfahrt“ als Abschied; und Abschiede haben etwas Endgültiges an sich, sie stimmen traurig. Jesus, der noch vor wenigen Augenblicken mit ihnen gesprochen hat wie ein Freund und Bruder, ist ihnen genommen. Seine Gestalt ist nicht mehr zu sehen, seine Stimme nicht mehr zu hören; der Platz, den er bisher eingenommen hat, ist leer.
Eine Redensart sagt: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Wird Jesus nicht bald vergessen sein, wenn ihn kein Auge mehr sieht? Wird sich seine Person und das, was er gewollt hat, nicht bald ins Unverbindliche verflüchtigen, wenn er nicht mehr da ist? Erinnerungen verblassen bekanntlich schnell. Und einer, der nur im Gedächtnis seiner Anhänger lebt, wird ihnen von Tag zu Tag fremder und entrückter.
„Aus den Augen, aus dem Sinn“: dieses Wort hätte recht, wenn „Christi Himmelfahrt“ einen wirklichen Abschied und Trennung bedeuten würde. Aber Jesus lässt ja seine Jünger gar nicht allein. „In den Himmel auffahren“ heißt gerade nicht, in eine Art himmlischen Aufzug zu steigen und in einen astronomischen Himmel wie in ein anderes Stockwerk zu fahren. Es ist ein Bild, ein literarisches Darstellungsmittel, um menschlich darstellbar zu machen, was den Verstand überfordert: Der Himmel, der Ort Gottes ist ja kein geografischer Ort und er hat keinen räumlich bestimmbaren Bezug. Der Himmel meint eine neue Art des Daseins im Raum des Göttlichen.
Jesus entschwindet zwar den „Augen“ seiner Jünger, aber er geht ihnen deswegen nicht aus dem „Sinn“. Im Gegenteil: Er dringt tiefer in den Sinn, in den Geist, in das Herz der Seinen ein. „Bleibt in mir und ich bleibe in euch“, hat Jesus ihnen als Bitte und Verheißung nach den Worten des Johannesevangeliums in der Rede vom Weinstock und den Rebzweigen gesagt (vgl. Joh 15,4). Er ist ihnen näher als je zuvor.
Im Grunde müssen wir „Christi Himmelfahrt“ nicht als Abschied, sondern als ein immer neues Kommen und Sein verstehen. Jesus zieht sich nicht von uns zurück, sondern ist uns auf neue Weise nahe. Wir können es uns in der Form eines kleinen Atemgebetes deutlich machen: Sagen wir in Gedanken beim Einatmen – Jesus, Du in mir – und nach einem kurzen Innehalten beim Ausatmen – und ich in Dir…
Diese Nähe soll uns Trost und Halt geben, will uns aber nicht weltfremd werden lassen. Jesus möchte nicht, dass wir gebannt zu ihm und zum Himmel hinaufschauen und die Welt vergessen. Er übergibt uns, indem er uns seine Nähe zusagt, zugleich seinen Auftrag: Geht… verkündet… heilt... lehrt… Was er begonnen hat, ist jetzt - mit ihm im Herzen - Sache der Jünger.
„Christi Himmelfahrt“ meint also nicht, dass Jesus sein Interesse an uns verloren hätte. Jesus bleibt vielmehr in unseren Herzen, was er immer gewesen ist: Der vom Vater her dem Menschen Zugewandte und die Liebe Lehrende. Madelaine Delbrel, eine Mystikerin der Straße in unseren Tagen, sagte es einmal so: Es geht beim Apostolat und in der Seelsorge nicht darum nur einen Auftrag zu erfüllen. Ich muss selbst Christus werden und Christus sein.
Der Auferstandene ist also jetzt schon der Kommende. Von allen zeitlichen und räumlichen Beschränkungen entgrenzt, bleibt er bei uns. Himmelfahrt Jesu heißt also: Er ist uns ganz neu und anders gegeben. Nicht: Er ist von der Erde verschwunden. Sondern: Er ist auf ihr auf unerhörte Weise gegenwärtig. Im Hl. Geist, in der Liebe, ist er in und bei uns bis zum Ende der Welt.
Ich möchte schließen mit einem Text von Peter Baumhauer (in: Josef Anselm Adelmann, Peter Baumhauer, Sieger Köder „Versöhnung. Bilder zu Passion und Ostern“, Stuttgart 1982, S.82):
Was bleibt, ist Licht.
Was bleibt, sind die Feuer von Ostern.
Was bleibt, ist die erleuchtende Nähe des Herrn.
Dunkelheit, Düsternisse sind auch;
Nächte der Trübsal, der Krankheit, der Kriege, die
Nächte des Todes. Ungerechtigkeiten regieren, Folter und Hohn.
Kain schwingt, als wäre nie Ostern gewesen, die Keule.
Hiob leidet an allen Straßen der Erde.
Dennoch: Die finsteren Wüsten der Welt sind durch
Ostern Felder geworden, die nach dem Samen des Guten verlangen.
Was bleibt, ist, die Äcker der Zeit mit Licht zu
bepflanzen im Namen des Herrn.
Was bleibt, ist, die Tische zu decken mit den Früchten des göttlichen
Lichts, mit Güte, Verzeihen, helfender Liebe,
Verstehen und Frieden.
Jeder sei Licht auf dem Acker der Welt.
Jeder brenne im Osterleben des ewigen Gottes.
Wenn alle entflammten von der Nähe des Herrn, vom
Zeichen seiner verzehrenden Glut, vom Zeichen
des Brots, des verwandelten Weines, dann wäre jeder,
gemeinsam mit Christus, dem andern eine stützende
Säule aus Licht auf den Wegen nach Haus.
Seid in der Nähe des Herrn gesegnet und behütet! Ihr P. Guido


 Bildergalerie
Bildergalerie