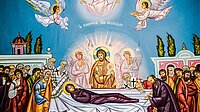Predigt zum 29. Sonntag im Jahreskreis (A) 1 Thess 1, 1-5b und Mt 22, 15-21
„So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört“ (Mt 22,21). Dieses Wort Jesu ist eines seiner bekanntesten Worte. Immer wieder wurde und wird mit ihm versucht, das Verhältnis zwischen „Gott und der Welt“ zu charakterisieren. Es wurde im Mittelalter herangezogen, um etwa das rechte Verhältnis zwischen Kaiser und Papst zu definieren, oder um in der Neuzeit die Beziehungen zwischen Staat und Kirche zu beschreiben. Es wurde benutzt als ein Wort, das diese Beziehungen auf den rechten Punkt bringen kann. Nun ist es keine Frage, dass jeder Christ und jede Christin immer zugleich Bürger einer gesellschaftlichen Wirklichkeit ist als auch Glied des Gottesvolkes. Das ist ein spannungsreiches Verhältnis, das bisweilen als Herausforderung erlebt werden kann oder sogar zu einem klaren Bekenntnis führen muss. Von den ethischen Maßstäben Jesu her kann dieses Spannungsverhältnis sogar zu Protest oder sogar zu Widerstand gegenüber staatlichen Gesetzen oder Anordnungen führen, wenn durch sie die Würde oder Freiheit des Menschen verletzt werden. Wir kennen aus der Geschichte viele Beispiele solch mutigen Verhaltens – man mag nur an jene denken, die beispielsweise in der Nazi-Zeit gegen die Willkür des Staates sich stellten, die jungen Menschen der Widerstandsgruppe ‚Die weiße Rose‘ oder der Jesuit Alfred Delp oder der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer und noch viele andere wären hier zu erinnern, die bis zum persönlichen Lebenszeugnis, bis zum Tod sich einsetzten. Es sind unzählige, die so als Märtyrer und Märtyrerinnen in vielen Ländern der Erde sich auf die Seite Gottes und damit auf die Seite der Menschlichkeit stellten und auch in unseren Tagen stellen.
Dennoch ist die Sinnspitze des Geschehens um das Jesuswort bei Matthäus ein wenig anders ausgerichtet. Die Situation, in die Jesus gebracht werden soll, ist als persönliche Falle von seinen Gegnern aufgebaut. Es ist kein ehrliches Gespräch, das hier begonnen und keine sachgerechte Diskussion, die hier losgetreten wird. Die Gegner Jesu wollen eine Antwort provozieren mit der Jesus hinterlistig in eine Streitsache hineingezogen werden soll, die damals höchst umstritten diskutiert wurde. In den religiösen Gruppen der Umwelt Jesu ist besonders die sogenannte Kopfsteuer der römischen Besatzungsmacht, sie betrug 1 Denar, das sind nach unserer Währung 64 €, der Streitpunkt. Da war die Gruppe der radikalen Zeloten, die die Kopfsteuer entschieden ablehnten, weil sie in dieser Steuer eine Einschränkung Gottes sahen; da sind die Pharisäer, eine strenggläubige Gruppe, die sie nur unter Protest zahlten und die realpolitische Gruppe der Sadduzäer, die sich aus einer Art Macht-Kooperation mit den Römern mit der Steuer abgefunden hatten. Und im einfachen Volk herrschte über die Kopfsteuer großer Unwille, weil sie den Menschen ständig die verhasste Fremdherrschaft zu Bewusstsein brachte.
Jesus durchschaut die Fragesteller in ihrer Falschheit und nennt sie Heuchler. Für ihn geht es nicht um irgendeine weltliche Macht. Der Kaiser in Rom ist für ihn ebenso wenig ein Konkurrent Gottes wie die eigene Obrigkeit. Ganz gleich, was die machen oder verordnen, sie tasten Gottes Anspruch an den Menschen nicht an. Jesus will sich nicht in die Streitigkeiten hineinziehen lassen, weil das nicht sein Thema ist. Sein Thema ist die Beziehung des Menschen zu Gott. Und es lautet: Wer ist Gott für alle Menschen und wer sind die Menschen für Gott. Gebt Gott, was Gott gehört. Darum geht es Jesus, alles andere ist zweitrangig. Theresa von Avila sagt später: Gott allein genügt – Solo dios, basta!
Nun, Jesus veranlasst seine Gegner, sich selbst die Antwort auf ihre Frage zu geben. Wir haben es gehört. Die Steuermünze trägt das Bild des Kaisers. Sie ist sein Eigentum, er hat sie prägen lassen und herausgegeben. Er hat die Macht dazu. Die Münze gehört ihm. Konsequent sagt Jesus: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört“ und in seinem Anspruch „und Gott, was Gott gehört.“
Was aber bedeutet „gehören“? Die Steuern gehören dem Kaiser, er hat ein Recht darauf, so der biblische Text. Jesus stellt das nicht in Frage. Die Gegner haben das sofort verstanden. Sie sind erstaunt und gehen beschämt weg. So steht es im nachfolgenden Vers im Evangelium bei Matthäus.
Was aber bedeutet „gehören“ im Blick auf Gott? Bin ich Gottes Besitz? Stehe ich ihm zu? So denkt Jesus nicht. So denkt Gott nicht, können wir sagen. Die Bedeutung ist eine andere: Gehören – zu-gehören – zu ihm gehören…, das ist es.
Bei Gott geht es um Beziehung, die Bibel spricht immer wieder davon. Einem anderen zu gehören, ihm zu – gehören, meint so, in Beziehungen zu ihm zu sein, meint nicht, in seinem Besitz zu sein. Der andere hat kein Recht über mich oder auf mich. Der eine steht dem anderen nicht zu. „Ich gehöre Gott“ bedeutet dann, ich bin auf Gott bezogen. Ich stehe in einer festen Beziehung mit Gott und zu ihm. Es ist eine wechselseitige Beziehung, in der jeder gibt und nimmt. Es ist eine Beziehung, die mich bereichert und in der jeder etwas gewinnt.
So gehöre ich Gott. Meine Beziehungsfähigkeit, meine Liebesfähigkeit gebe ich Gott. Und zusätzlich möchte ich ergänzen: Das beruht auf Gegenseitigkeit. Gott gehört auch mir. Er will mit mir in Beziehung sein, will mir geben, was das wirkliche Leben ausmacht, was ich wirklich brauche, Leben und Freiheit und Würde, weil er mich, weil der den Menschen liebt.
„Gebt Gott, was Gott gehört.“ Gebt Gott eure Fähigkeit und Freiheit, euch auf Gott zu beziehen, mit ihm verbunden zu sein, aus ihm und auf ihn hin zu leben.
„Gebt Gott, was Gott gehört.“ Ich versuche, mich als ganzen Menschen auf Gott zu beziehen und von ihm her zu leben, und ich weiß, dass dieser Versuch immer begrenzt sein wird, immer Versuch, immer halbes Gelingen, immer nur Bruchstück. Ich bin eben ein Mensch.
Macht nichts, sagt Jesus. Am Ende gehören wir ganz zu Gott, weil er uns liebt.
Seien Sie gesegnet und behütet! Ihr P. Guido




 Bildergalerie
Bildergalerie